
Nach 1700 Jahren
Der jüdisch-deutsche Bruch, Nostalgie und das Judentum der Politik
Y. Michal Bodemann
Bilder von Eran Shakine
»a Muslim a Christian and a Jew«
Die Ausstellung wird nächstes Jahr
im Khan Museum, Toronto, Canada zu sehen sein.
Instagram: eran.shakine
www.eranshakine.art
Das erste Zeugnis jüdischen Lebens auf deutschem Boden ist ein Edikt des Kaisers Konstantin zur Mitgliedschaft von Juden in der »curia« der Stadt Köln. Aufgrund dieses Edikts gründete sich im April 2018 in Köln der Verein »321 - 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Gründungsmitglieder waren unter anderen der Zentralrat der Juden in Deutschland (ZJD) mit seinem Vizepräsidenten, die Stadt Köln mit ihrer Bürgermeisterin und das Land Nordrhein-Westfalen mit ihrem ehemaligen Ministerpräsidenten. Eine lange Reihe weiterer kirchlicher und politischer Institutionen sind mit diesem Verein assoziiert. Ziel des Vereins ist die Koordinierung eines »Festjahres« um – so der Vorsitzende des Zentralrates, Josef Schuster – »Bewusstsein für 1700 Jahre Judentum in Deutschland zu schaffen.«Februar erschienen in einer reich bebilderten Beilage der vom ZJD herausgegebenen wöchentlichen »Jüdischen Allgemeinen« (AjW), angefangen mit den Grussworten des Bundespräsidenten, der Kanzlerin, der Kölner Bürgermeisterin, und des Aussenministers. Hier also handelt es sich um eines von vielen Joint Ventures zivilgesellschaftlicher und staatlicher Institutionen.Die Frage ist nun, welche Rolle aber spielen diese Institutionen in diesem Zusammenhang, wie wird im Festjahr die jüdische Gemeinschaft dargestellt, wie wird sie erfunden? Zunächst handelt es sich hier um eine verwegene Genealogie, denn – worauf der russisch-jüdische Historiker Simon Dubnow bereits hinwies – blieben nach 321 die Juden für die folgenden 700 Jahre in Köln und andernorts im naturalwirtschaftlichen Deutschland nicht auffindbar, im Gegensatz zu französischen und spanischen Regionen (Dubnow, Bd. 4,53-54:1926). Köln im 4. Jahrhundert, mit Latein als Verkehrssprache, war also ein letzter Ausläufer des spätrömischen Reiches und keineswegs eine deutsche Stadt. Erst wieder 1026 wissen wir vom Bau einer Synagoge in Köln. 1096 – zur Zeit des ersten Kreuzzugs – wird vom furchtbaren Wüten, von Massakern, jüdischen Suiziden und den Zwangstaufen durch den Mob gegen die Kölner Juden und Juden andernorts berichtet.


Sowohl die besagte Beilage als auch weitere Erklärungen zum Festjahr thematisieren neben dem frisierten Alter der jüdischen Präsenz in Deutschland insbesondere auch das »jüdische Erbe« (Josef Schuster), die »Zugehörigkeit der Juden zu Deutschland« (Steinmeier), das bereichernde jüdische »Leben und Wirken in unserem Land«(Angela Merkel) oder die »jüdischen Wurzeln«, die unser »gesellschaftliches Zusammenleben« prägen (Heiko Maas). Diese und viele ähnliche Erklärungen zur Verwurzelung verdeutlichen also unfreiwilliger Weise gerade das Anderssein der Juden in Deutschland heute. Dies wird deutlich, wenn wir uns Selbstbestimmungen aus früheren Zeiten ansehen.
Im Jahre 1921, also vor 100 Jahren, wurde jüdischerseits bereits knapp auf das Edikt Kaiser Konstantins hingewiesen. Während heute anlässlich des Festjahres von nichtjüdischer Seite von der Beheimatung der Juden in Deutschland gesprochen wird, war es damals ironischerweise die jüdische Seite, die vor allem angesichts des rapide anwachsenden Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg die Verwurzelung der Juden in Deutschland beschwor. »Kein Land,« so hiess es in der Zeitschrift des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, sei »den Juden so sehr Heimat geworden wie Deutschland… Während sie in Palästina insgesamt 1400 Jahre gelebt hatten, wohnen sie hier bereits 400 Jahre länger.« Die »rassebildende Kraft« des Bodens, des Klimas, und der Umwelt genüge, innerhalb bereits eines Zeitraumes von 200 Jahren »fremde Volksteile vollständig zu assimilieren.« In derselben Ausgabe wird eine einstimmig angenommene »Entschliessung« des CV vom November 1921 veröffentlicht. Sie beginnt mit den Worten, »Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens schart seit seiner Gründung die deutschen Juden um das Banner des Deutschtums.«
Im Jahr darauf, 1922, folgt auch die neue, wöchentlich erscheinende »CV-Zeitung« diesem Duktus der Juden und Nichtjuden als nur auf religiöser Basis differenziert. Hier ist von »unseren nichtjüdischen Volksgenossen« die Rede, und hier wie schon in der Monatszeitschrift im Jahr davor, ist die Rede von den Mitbürgern »aller Bekenntnisse« und davon, dass es »in uns keine Faser und keinen Blutstropfen gibt, der nicht gleichzeitig jüdisch und deutsch ist«.
Diese emphatische Betonung der deutschen Identität (und dem Zionismus der jüngeren Generation damals) ist vor allem nachvollziehbar auf dem Hintergrund des rapide anwachsenden Antisemitismus nach 1918. Ohne diesen breit gefächerten Hass in den 15 Jahren vor 1933 ist die Shoah selbst kaum zu erklären, was auch das Gerede vom »Zivilisationsbruch«, Verbrechen geschrumpft auf Juden in den Vernichtungslagern, fragwürdig macht. Wie viele Millionen Ermordete braucht es für einen Zivilisationsbruch? Reicht eine Million, oder geht es schon bei Hunderttausend los? Dem Genozid an den Hereros zum Beispiel? Der Diskurs über das tiefe deutsche Empfinden vieler Juden noch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts führt uns zur Frage deutscher und jüdischer Identitäten nach 1933.
Die Schoah führte zu einem unerbittlichen, tiefgreifenden Bruch im Verhältnis von Juden und Deutschen. Hier wird oft vergessen, dass über die Jahrhunderte Juden und Deutsche vielleicht ethnisch distanziert, rechtlich diskriminiert, aber kooperativ in wechselseitigem Interesse miteinander lebten. Viel haben jüdische Chronisten und später die Geschichtswissenschaft völlig zurecht über die horrenden Massaker und Vernichtungen ganzer jüdischer Gemeinden geschrieben – soviel zur »lacrimose version of Jewish history« (Salo Baron), über einen ereignislosen und routinemässigen Alltag zwischen Juden und Deutschen, gerade auch jüdischen und deutschen Frauen, lässt sich dagegen weniger gut berichten.
In den letzten Jahren hat sich diese Sicht geändert und neuere Forschungen belegen, dass Juden auch als Minorität ein selbstbewusstes Leben führen konnten. Juden wurden also nicht nur grotesk an Kirchendächern dargestellt, sondern durchaus auch, worauf Frank Stern hingewiesen hat, in grosser Schönheit, wie etwa als »Synagoga« am Strassburger Dom, im Vergleich zu der eher plumpen »Ecclesia« daneben. Warum diese antijüdischen Darstellungen an Kirchen, weniger jedoch an anderen Gebäuden, Burgen und Rathäusern, zum Beispiel? Hat es nicht damit zu tun, dass die Kirche das Judentum als Konkurrentin angesehen hat?
Über die Jahrhunderte waren die Juden nicht nur ein besonderer ethnischer Block mit seinen eigenen mobilen Institutionen und Gesetzen, sie waren selbstverständlich in das öffentliche und kulturelle Leben mit eingebunden. Wie erklären wir denn sonst zum Beispiel die Tatsache, dass das musikalische Liedgut, etwa der zu Pessach gelesenen Haggadah, in Teilen mit dem deutschen Liedgut faktisch identisch ist?
Dieser durch den Holocaust erzeugte Bruch liegt jenseits von Sympathie oder Antipathie. Über die Jahrhunderte entliehen sich deutsche Juden und Deutsche wechselseitig kulturelle Praktiken. Auch anti-jüdische und anti-christliche Praktiken, wie sie etwa Ivan Marcus beschrieben hat, bildeten eine Verbindung zur jeweils anderen Seite – wenngleich eine negative. In freundlicher Nachbarschaftlichkeit wiederum wurden zu Ostern und Pessach wechselseitig Mazzot und Gebackenes, später Ostereier, geschenkt, und die eigene Lebenswelt, die eigene Gemeinschaft, später Nation, schloss die jüdische Gemeinschaft mit ein.
Die Politik der Nationalsozialisten erzeugte deshalb einen Bruch, der Jahrhunderte jüdisch-deutscher Beziehungen zunichte machte; einen Bruch, der tief an alle persönlichen Beziehungen, Freundschaften wie Antipathien rührt, aus allen Schichten der Gesellschaft, nicht zuletzt der Unterschicht. Anders ist auch die Entstehung des Rotwelschen Jargons nicht zu erklären. Die Konsequenzen dieses Bruchs versuche ich im folgenden zu skizzieren.

Der Bruch und die Folgen
Laut Volkszählung vom Juni 1933 befanden sich knapp 500000 Juden auf dem Territorium des Deutschen Reiches, im Gegensatz zu zirka 600000 vor dem ersten Weltkrieg. Die Abnahme erklärt sich aus der relativ niedrigen jüdischen Geburtenrate und den Auswanderungswellen nach Nord- und später Südamerika.
Gerade zu dem Zeitpunkt, da die alteingesessenen Juden in der deutschen Gesellschaft unsichtbarer wurden und sich in der Oberschicht und vor allem in den oberen Mittelschichten zu integrieren begannen, nahmen die rechtskonservativen und faschistischen Elemente den Zustrom der pauperisierten Ostjuden zuhilfe, um die antisemitische Hetze weiter anzuheizen.
Ein Bruch freilich setzt voraus, dass es Verbindendes gab, und tatsächlich waren Juden und Deutsche, gerade in den Jahren vor 1933, auf das Engste organisch miteinander verknüpft. Dies drückte sich vor allem dadurch aus, dass Juden in scheinbar unauflösliche alltägliche Kontakte mit Deutschen getreten waren und sich in wirtschaftliche wie institutionelle gesellschaftliche Bereiche weitgehend eingefügt hatten. Von Nachbarschaftlichkeit ganz abgesehen war der Kontakt zu Juden zunächst besonders hoch in freien akademischen Berufen wie bei Anwälten und Notaren oder Ärzten, in denen der Anteil der Juden an der Berufsgruppe insgesamt 16 Prozent respektive 10 Prozent betragen hatte.
Auch ca. ein Zehntel aller Handelsreisenden und eine hohe Anzahl von Verkäuferinnen und Verkäufern waren Juden. Die Rolle von Juden war von wesentlicher ökonomischer Bedeutung, weshalb auch lange nach den ersten diskriminierenden Gesetzen im Jahre 1933 Ausnahmeregelungen für Juden in diesen Positionen geduldet werden mussten. Die institutionelle Verknüpfung war darüber hinaus besonders eng innerhalb bestimmter Berufsorganisationen, bestimmter Klubs, des Kulturbetriebs und der politischen Parteien
Diese alltäglichen Kontakte und institutionellen Verknüpfungen fanden weiterhin ihren Ausdruck im Bereich verwandtschaftlicher Verbindungen, obgleich hier nur grobe Schätzungen möglich sind. So müssen wir um das Jahr 1933 von mindestens 60000 Mischehen ausgehen.Anfang 1930 gingen 20 Prozent der Heiratenden eine Mischehe ein. Rund 250000 Personen waren »Mischlinge« nach der Definition der Nürnberger Gesetze, d.h., sie hatten einen oder zwei jüdische Großeltern. Diese Mischlinge stellten in sehr direkter Weise eine organische Verbindung zwischen Deutschen und Juden her, denn normalerweise besassen sie sowohl »arische« wie auch rein jüdische Verwandte. Doch diese Zahlen aus den statistischen Jahrbüchern liefern nicht das vollständige Bild. Folgen wir den heutigen, gerade auch nord-amerikanischen Demographen, so müssen wir den Ethnos innerhalb konzentrischer Sphären betrachten.
Die innerste jüdische Sphäre wäre dementsprechend die der Orthodoxie und anderen Formen des traditionellen Judentums innerhalb geschlossener verwandtschaftlicher Kreise , zwischen religiösen und agnostischen Familienmitgliedern bis hin zu gemischt jüdisch-nichtjüdischen Haushalten und schliesslich zu Haushalten mit nur einem, etwa zum Judentum übergetretenen Mitglied ohne besondere jüdische Verbindungen.
So gerechnet hatten viele Juden und Jüdinnen deshalb auf Verwandtschaftsebene allein intensive und relativ enge Beziehungen zu Nichtjuden und umgekehrt – wobei diese Bindungen gewiss klassenspezifisch waren: gering in der Aristokratie, mit signifikanten Ausnahmen, gering unter den Bauern und in der Arbeiterklasse, intensiver in Teilen der Bourgeoisie und besonders ausgeprägt in den Mittelschichten. Kurzum, auf institutioneller wie verwandtschaftlicher Ebene waren Deutsche und deutsche Juden durch reale materielle Interessen verbunden. Der jüdische Raum war also keineswegs abgeschlossen, sondern hatte ein breites nichtjüdisches Umfeld, im Unterschied zu heute in Deutschland.
Der Ausschluss
Wie war es nun angesichts dieser engen organischen Verknüpfung den Nazis möglich geworden, Anfang der vierziger Jahre deutsche Juden einfach zu deportieren und zu vernichten, praktisch ohne jeglichen kollektiven Widerstand? Die üblichen Erklärungen beziehen sich auf den Charakter des faschistischen Staatsapparates, der mit dem Regime sympathisierenden Kirchen, der »autoritären Persönlichkeitsstruktur« in Deutschland, der politischen Schwäche jüdischer Verbände und Ahnlichem.
Als Teilerklärungen haben diese eine gewisse Gültigkeit. Sie reichen aber nicht aus. So hat sich der Berliner Politologe Ekkehart Krippendorff vor vielen Jahren etwas naiv gefragt, warum Juden in Deutschland damals keinen privaten Widerstand geleistet haben. Eine wichtige Erklärung hierfür war die Strategie der sozialen Trennung von Juden und nichtjüdischen Deutschen vom 1. April 1933, also kurz nach der Machtübernahme. Boykottaufrufe wie etwa der Slogan, »kauft nicht bei Juden« waren ein wichtiges Instrument, und die Repressalien Terror gegen diejenigen Deutschen, die sich noch in den ersten Monaten für einzelne Juden eingesetzt hatten ebenfalls. Ohne diese soziale Segregation ist die Vernichtung des deutschen Judentums kaum denkbar.
Also wurden zunächst die Juden aus den allgemeinen institutionellen Strukturen ausgeschlossen. Vor allem die eher liberale und linke Intelligenz verlor die Möglichkeit, sich über öffentliche Medien zu artikulieren und zur Wehr zu setzen. Darauf folgte unmittelbar, angefangen mit dem Boykott gegen jüdische Geschäfte, die Trennung in einen deutschen und einen – fragmentarischen – jüdischen Wirtschaftsbereich, sodann, und das ist besonders einschneidend, der Bruch auf der Ebene verwandtschaftlicher Bindungen. Die Nürnberger Gesetze, das »Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«, vom September 1935 verbot zunächst einmal Ehen zwischen Deutschen und Juden und definierte zum Zweck der völligen Segregation, Juden und Deutsche »risch« – tatsächlich jedoch in einem soziologischen Sinne. In seinem Band, »Die Jahre der Verfolgung 1933 -1939« hat Saul Friedländer diesen Vorgang sehr plastisch beschrieben.
Kurz, es ging in den nazistischen Strategien also zunächst darum, vermittels administrativer Maßnahmen und der Polizei einen radikalen Bruch zwischen Deutschen und Juden herzustellen – einen Bruch, der gerade auch im familiären Bereich die Verbindungslinien abriegeln, Kommunikation, Hilfeleistungen und Solidarisierung gegenüber Juden unmöglich machen sollte. Vieles davon fand im Privaten statt und konnte zweifellos in seiner Gesamtheit von der Bevölkerung auch trotz zunehmendem Hass auf Juden kaum begriffen werden. Hier nun kommen die Novemberpogrome 1938 ins Spiel. Im Gegensatz zu den in der Bevölkerung weitgehend ignorierten früheren Schikanen und vor allem der Rechtlosigkeit der Juden wurde nun der erfolgreiche Abschluss dieser Entrechtung vor allem durch die brennenden Synagogen bildhaft und in grosser Sichtbarkeit als Degradierungszeremonien in Szene gesetzt. Symbolisch nicht weniger wichtig waren die Plünderungen privater Haushalte: wo Mobiliar und bürgerliche Häuslichkeit auf der Straße landen, verschwinden ziviles Kommunizieren, wird die Leugnung des Rechts, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt es ausdrückte, konkret sichtbar.
Trotz alledem gab es vereinzelt auch später noch Fälle der Solidarisierung. Die bedeutsamste, grösste, Protestaktion gegen die Nazis überhaupt, eine Aktion, die sich über mehrere Tage hinzog, war der Rosenstraßen-Protest Ende Februar 1943 in Berlin. Damals versammelten sich Hunderte, zum Teil Kochtöpfe schwingende »arische« Angehörige inhaftierter jüdischer Männer gegen deren Abtransport. Diese Apartheidspolitik avant la lettre wurde in den Jahren 1939/40 abgeschlossen. Die großen Deportationen konnten beginnen.
Dies hatte freilich andere weitreichende Konsequenzen, die hier wichtig sind. Ob man die Juden nun mochte oder nicht, sie waren über die Jahrhunderte, aber am ausgeprägtesten im 19. und 20. Jahrhundert im allgemeinen gesellschaftlichen Bewußtsein und im engeren kulturellen Bereich ein fester Teil der deutschen Nation geworden. Das zeigte sich nicht nur im deutschen, sondern, wie wir gesehen haben, in einer Einheit von Deutschtum und Judentum.
Hier eben war auch identitätsstiftend wichtig, dass Hunderttausende von Deutschen aus Mischehen hervorgegangen waren und dass sich, zunehmend, viele andere Deutsche mit jüdischen Partnern verheirateten. Dass diese Idee der Blutsverwandtschaft tief ins deutsche Bewußtsein eingegraben war und so die nationale Identität zu definieren half, war den Nationalsozialisten sehr wohl bewußt. Die antisemitische Propaganda mußte also darauf abzielen, die nationale Selbstdarstellung, die das jüdische Element miteinschloß, auf ihre »arischen« Wurzeln zu reduzieren, was in der Namensgebung der Nürnberger Gesetze, »Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«, ja zum Ausdruck kommt.
Deutlich wird das vor allem in Goebbels’ Propagandafilm »Der ewige Jude«, der als unmittelbarer Auftakt zu den Massenvernichtungen gesehen werden muß. Dieser sich dokumentarisch gebende Film beginnt mit optisch verzerrten Darstellungen verarmter, traditioneller Juden in den polnischen Ghettos, und geht erst dann daran, Juden in Westeuropa darzustellen: Juden in der Maskierung anderer Völker, »in der Pose des englischen Lords«, oder Juden, die sich »fast wie Franzosen« zu »bewegen verstehen«. Dies ist, in diesem Film wie anderswo, neben dem Bild des Juden als Ausbeuter, das wesentlichste Element der nazistischen Propaganda: Juden sind nicht, sie erscheinen nur organisch eingebettet in das deutsche Volk. In Wahrheit sind sie »Gastvolk«, ja eine andere Species, Ratten ähnlich, wie die widerliche Einblendung in Goebbels’ Film zu suggerieren sucht.

Jüdische Neudefinition
Die kollektive Identität der nichtjüdischen Deutschen wurde also neu definiert; was geschah mit der kollektiven Identität der Juden? Ob von den Nazis intendiert oder nicht, die erzwungene Segregation und der nazistische Rassismus führten gerade auch unter deutschen Juden zu einem in der Weimarer Zeit bereits entwickelten, doch nun breiter etablierten neuen Identitätsverständnis. Erst der nazistische Rassismus verwandelte die jüdischen Deutschen in eine »Rasse«, und damit in einen getrennten ethnisch-nationalen Block: Jüdisches Leben erfuhr mit der anwachsenden antisemitischen Hetze und den sie isolierenden Maßnahmen eine außerordentliche Bereicherung. Juden und Jüdinnen in Deutschland wandten sich nun gezwungenermaßen nach innen und besannen sich auf jüdische Traditionen und Werte; eine Entwicklung, die bereits vor 1933 begonnen hatte. Zionismus, der neugegründete jüdische Kulturbund, jüdische Schulen, Jugendorganisationen, Lehrlingsausbildungsstätten und viele andere lokale wie nationale jüdische Institutionen schufen dafür die notwendigen sozialen Grundlagen. Der Zionismus, der hier früher wenige Anhänger gefunden hatte, bot der jüdischen Jugend nun eine begeisternde Vision. Mit der zwangsweisen Vereinheitlichung des organisatorischen Bereichs wurde nun auch die ostjüdische Kultur umgewertet, wie die einflußreichen Arbeiten von Martin Buber, Franz Rosenzweig oder Gershom Scholem und Arnold Zweig beweisen.
Nach Kriegsende
Was blieb von diesem sozialen Bruch zwischen Juden und Deutschen nach Befreiung der Lager, nach Kriegsende, noch übrig? Hier stellte sich heraus, dass mit dem Ende der Naziherrschaft die sozialen Beziehungen zwischen Juden und Deutschen keineswegs zum Stand von vor 1933 wiederhergestellt wurden. Viele Beobachter der Nachkriegszeit, oft aus eigenem Erleben, so etwa der Verleger Bermann Fischer, waren schockiert über die erstaunliche Virulenz des Antisemitismus, zumindest in Westdeutschland. Er reproduzierte sich sowohl im Geist der Goebbelschen Propaganda wie auch als Nachwirkung der gesamten antisemitisch-nazistischen Strukturierung vor allem der Kultur bis hin zu sozialen Beziehungen in Familie und Schule. In meiner eigenen Verwandtschaft brachen die Beziehungen zwischen den jüdischen und den nichtjüdischen Verwandten ressentimentgeladen ab, oder wurden »vergessen«. Der selbstverständliche tägliche Umgang miteinander von vor 1933 war verschwunden, denn diese Juden waren weitgehend nicht nach Deutschland zurückgekehrt und die DPs (displaced persons), Flüchtlinge aus dem Osten, blieben, so gut es ging, unter sich.
In dieser frühen Phase nach 1945 bezeichneten sich die jüdischen Gemeinden überdies als »Liquidationsgemeinden«, das heißt, als in Auflösung begriffene Strukturen, da jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 für unmöglich gehalten wurde; nicht zuletzt weil Juden und Israelis andernorts in Deutschland lebende Juden mit einem Herem (Bann) belasten wollten. Tatsächlich war dies jedoch nur eine Fortführung des Prozesses, der in den mittdreißiger Jahren begonnen hatte, als jüdische Organisationen zunächst noch aus eigenem Antrieb die Emigration forcierten, dann auf Geheiß der Gestapo dazu gezwungen wurden, ihre eigene Liquidation und die ihrer Mitglieder zu organisieren. Diese Liquidationsideologie lebte lange nach 1945 noch fort in einem Teil der jüdischen Nachkriegsgeneration, wo ein beträchtliches Kontingent, typischerweise nach dem deutschen Abitur ab etwa 1965 ihre Alijah (Auswanderung nach Israel) betrieb. In einigen Fällen wurde diese Alijah hoch deklamatorisch betrieben, und der Antisemitismus in der Bundesrepublik dafür verantwortlich gemacht. Einige dieser Auswanderer fanden sich freilich schnell wieder in Deutschland wo sie dann oft öffentlichkeits-orientierte Karriere machten, und ihre mögliche Alijah als Drohung weiter in den Raum stellten.
Diese Kontinuität zeigt sich ironischerweise auch in der unfreiwilligen Fortführung einer nazistischen Sprachregelung. Die wichtigste jüdische Organisation bis 1933 war der »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens«, von Tucholsky als »Centralverein deutscher Staatsjuden bürgerlichen Glaubens« karikiert. Ihm folgte Im September 1933 die »Reichsvertretung der deutschen Juden«, die nun auch Zionisten einschloß, doch zwei Jahre später auf Befehl von Goebbels in »Reichsvertretung der Juden in Deutschland« umbenannt werden mußte. Gerade diese ursprünglich aufgezwungene Konzeption, »Juden in Deutschland«, wurde 1949 von deren Nachfolgeorganisation, dem Zentralrat der Juden in Deutschland sowie zunächst auch der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland fortgeführt. Sie charakterisiert jedoch in erster Linie die Kontinuität des neuen jüdischen Selbstverständnisses seit 1935 und den Bruch mit der deutsch-jüdischen Identität davor. Die russischsprachige Einwanderung seit den 80er Jahren tat ein übriges gegen eine Rückkehr zum »deutschen« Judentum.

Nach 1989
Heute leben in Deutschland, konservativ geschätzt, 200000 Juden, wovon etwas über die Hälfte registrierte Gemeindemitglieder sind. Wie war es dann also möglich, dass sich jüdische Gemeinden nach Auschwitz in einem deutschen Staat neu etablierten, und welche Rolle spielen Gemeinden und Zentralrat heute? Es gibt wichtige politisch-ideologische Gründe dafür, dass Juden als Kollektivität in die Bundesrepublik zurückkehren konnten und darüber hinaus privilegiert behandelt wurden im Vergleich zu anderen Ausländergruppen – und sie waren in der Mehrzahl Ausländer , also Migranten und wenigstens nicht Rückgekehrte.
In den Nachkriegsjahren befand sich die Bundesrepublik ohne Juden im westlichen Ausland politisch stigmatisiert und kulturell isoliert; von der Lage der DDR nicht zu sprechen. Grund für diesen Paria-Status war vor allem der durch Krieg und Schoah begründete, rachegefüllte Hass von Juden und Nicht-Juden weltweit auf Deutschland; zweitens die provinzielle, spießige Atmosphäre, und mit die wichtigste Erklärung hierfür ist, dass Hitlers exterminatorisches Programm, Deutschland »judenrein« zu machen, weitgehend erfolgreich war, denn häufiger waren es Juden, die vor dem Holocaust international, von Ost- nach Westeuropa und Nordamerika die notwendigen sozialen, kulturellen, und wirtschaftlichen Ressourcen anbieten konnten – den Nahen Osten nicht ausgeschlossen. Wie steril die intellektuelle Atmosphäre in der deutschen Nachkriegszeit war, zeigte sich beispielsweise daran, dass die Rückkehr zweier Emigranten sich nachgerade als Skandal darstellte und so ihnen erst in Deutschland ihre spätere hervorgehobene Position ermöglichte.
Die Rede ist von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, die in New York ein eher unscheinbares Leben in Hinterzimmerbüros einiger Universitäten gefristet hatten. Andere emigrierte Intellektuelle dagegen, etwa Herbert Marcuse oder Hannah Arendt, hatten es durchaus geschafft, sich in den USA zu etablieren.Um sich aus der Isolation zunächst einmal politisch zu lösen, mußten deshalb die Reparationsverhandlungen zwischen Nahum Goldmann und Konrad Adenauer abgeschlossen werden. Derselbe Adenauer hatte zwar nicht gezögert,, sich ausgerechnet von Hans Globke, dem Kommentator der Nürnberger Gesetze, beraten zu lassen. Gleichzeitig fand Adenauer jedoch, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für die Bundesrepublik waren. Nicht zuletzt auch erleichterten ehemals deutsche, mit der US-Armee zurückgekehrte Juden und Jüdinnen mittels ihrer Sprachkenntnisse, ihrer juristischen Kenntnisse, verwalterischen Praktiken sowie internationaler Freundschaften oder Geschäftsbeziehungen als Vermittler die internationalen Kontakte. Dies fand vor allem statt im politischen Terrain, aber auch im geschäftlichen und persönlichen Bereich.
Vor allem auch in der Frühzeit der Bundesrepublik war es Usus für deutsche Politiker auf Staatsbesuchen in Israel oder den USA, jüdische Repräsentanten mitzunehmen um die internationalen Kontakte zu entspannen und psychologisch zu erleichtern. Wenig war den Politikern bewusst, dass diese jüdischen Repräsentanten ausserhalb Deutschlands als Verräter am jüdischen Volk gesehen wurden und ihre Begleitung eher kontraproduktiv war.
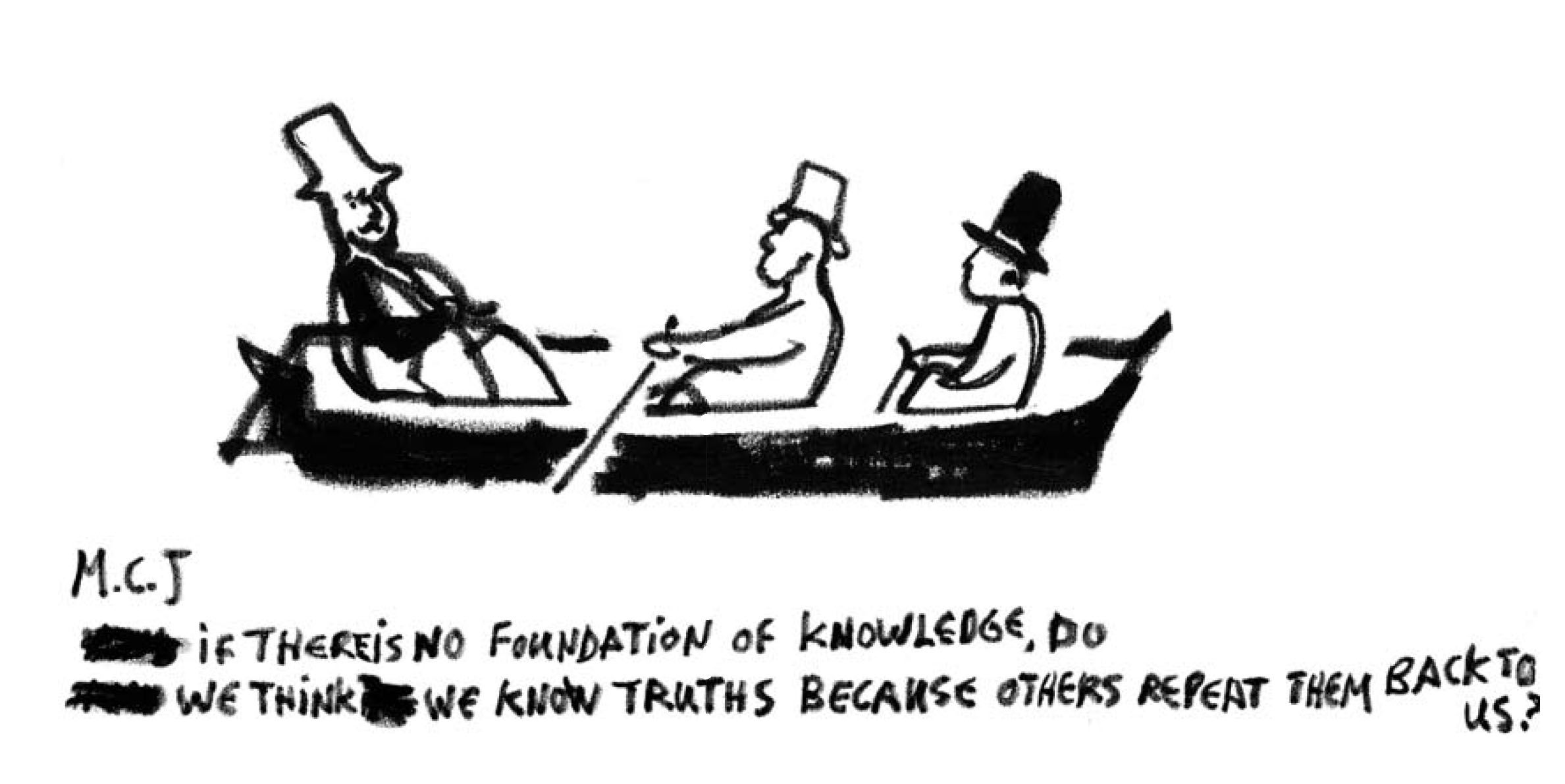
Die wesentlichste Kontinuität
Die wesentlichste Kontinuität über 1945 hinaus war freilich das Überleben des Nazismus in der Zivilgesellschaft, von den Sportverbänden und der Wirtschaft über den Richterstand und die Lehrerschaft bis hin zur Ärzteschaft und dem ADAC, der seine Mitglieder ja bis in die siebziger Jahre noch in »Gauen« regional organisierte. Im Gegensatz zum »Antifaschismus« und Sozialismus in der DDR war in der Bundesrepublik damit zunächst auch keine alternative Ideologie verfügbar, kein Mythos der Résistance wie in Italien oder Frankreich, mit dem man sich vom Nazismus unterscheiden konnte.
Im Kalten Krieg und unter dem vom rheinischen Katholizismus geprägten Bundeskanzler Adenauer kam so ein christlicher Diskurs zu seiner Rolle als staatstragende Ideologie, nachdem sich zunächst nach 1945 eine goetheanische Innerlichkeit breit zu machen versuchte. So wurde deshalb die Betonung positiver Beziehungen zu Juden und zum Staat Israel und das Gedenken an Auschwitz, Auschwitz als religiös erfahrbare Katastrophe, ein Ersatzdiskurs; der Antisemitismus als zentrales Herrschaftsinstrument der Nazis wurde umgedreht in einen religiösen Philosemitismus als Legitimationsprinzip. Man denke hier nur an die vielen Adolf-Hitler-Strassen, die in Martin-Luther-Strassen umgetauft wurden und auch heute noch sind die Programme der öffentlichen Rundfunkanstalten am Sonntag Morgen voll belegt mit katholischen oder evangelischen Gottesdiensten; kein Vergleich hier zu der mageren Präsenz der Muslime in Rundfunk und Fernsehen heute.
Juden und Jüdinnen sind per se religiös; wenn jüdische Männer keine Kippot tragen und Frauen ihre Arme und Beine nicht bedecken, werden sie nicht als Juden oder Jüdinnen gesehen. Der religiöse Diskurs war darüber hinaus auch Gegengewicht gegen die kommunistische Propaganda aus der DDR. Im Westen wurden persönliche Beziehungen zu Juden eine besondere Ressource dann, wenn sie, wie im Falle der engen Beziehung des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten und »furchtbaren Juristen« Filbinger zum damaligen, korrupten, Vorsitzenden des Zentralralrates der Juden, Werner Nachmann, die nazistische Vergangenheit zu übertünchen oder von deren Verbrechen Absolution zu erteilen halfen. So ergibt sich, dass die ehemaligen Opfer zu Komplizen gemacht werden sollten.
Sowohl in der ersten Nachkriegszeit bis etwa 1968 und der darauffolgenden Phase bis zur Vereinigung wurde das Wiederaufleben der jüdischen Gemeinden vom Staat wohlwollend gefördert, was man von der individuellen Wiedergutmachung gegenüber Einzelpersonen zumeist nicht behaupten kann. Im Austausch für diese staatliche Förderung des Judentums wurden ihre Repräsentant*innen – unvorstellbar in der Weimarer Republik – in die Rolle von Apologeten, von Hofjuden gebracht. Als Juden stellen sie geradezu körperlich den Anti-Nazismus dar, und wurden deshalb als Antidote gebraucht. Ohne spätere Vorsitzende des Zentralrats, und ohne andere jüdische Akteur*innen, vor allem ohne Fritz Bauer, der 1965-66 die Anklage im Auschwitz-Prozess in Frankfurt/M führte, hätte sich das politische Klima weiter nach rechts bewegt. Was jüdische Repräsentant*innen zu sagen haben, ist eminent politisch, und doch bleiben sie dabei politisch machtlos. Wäre dem nicht so, dann hätten ihre unermüdlichen Hinweise auf unbestrafte Naziverbrecher in einer höheren Verurteilungsrate resultiert.
Was die christlich und die jüdisch politisierten Diskurse in der Bonner Republik angeht, so muss der facettenreiche und doch auch problematische »christlich-jüdische Dialog« auf jeden Fall gewürdigt werden, weil er hier auch eine progressive und demokratisierende Rolle gespielt hat. Es ist die Anerkennung des Anders-Seins auf Kirchentagen, Wochen der Brüderlichkeit, Verbindungen nach Israel und ähnliches. Er weist der jüdischen Gemeinschaft als subalterne Gruppe eine Form ideologischer Arbeit zu: damit meine ich Aktivitäten, Werte, passiv-aktive Präsenzen und Zeugenhaftigkeiten die die identitären Strukturen der dominanten Sphäre fortlaufend neu reproduzieren. Dies geschieht zumeist aufgrund kontrastierender Lebensweisen zwischen der subalternen Minorität und der Mehrheitsgesellschaft.
Neues Judentum
Ich habe hier vom jüdisch-deutschen Bruch nach 1933 geschrieben und die Frage ist, was ist an seine Stelle jüdischerseits nach Ende der Naziherrschaft getreten? Meine These ist, dass die jüdische Gemeinschaft in Deutschland institutionell einzigartige Charakteristiken vorweist. Seit Gründung war der Zentralrat vor allem mit Wiedergutmachungsfragen, auch mit Kultus und Sozialhilfe beschäftigt. Daher verbrachte sein Personal ein Grossteil von Zeit und Ressourcen in Verhandlungen mit staatlichen Behörden, etwa um gemeindlichen und privaten jüdischen Besitz, der in der Nazizeit konfisziert worden war, rückgängig zu machen. Diese mühselige Arbeit haben das Personal des Zentralrats mit grosser Hingabe und Zähigkeit gemacht – eine wenig gewürdigte Leistung. Ähnlich war der Zentralrat seit den 80er Jahren sehr gefordert mit der Integration der russisch-sprachigen Juden. Zugleich wurden die jüdischen Funktionäre deutscherseits gebraucht als Erinnerungswächter bei staatlichen Gedenkveranstaltungen zum Holocaust. Diese sichtbare Präsenz der Juden erfüllte den Zweck, den Horror der nazistischen Verbrechen an den Juden abzumildern, denn wenn selbst Juden wieder in Deutschland leben, dann, so die Annahme, hat sich alles etwas beruhigt und Juden sind den Deutschen wieder gut. Die kulturelle Nähe zu Deutschland innerhalb dieser jüdischen Führung erleichterte dies: sämtliche Vorsitzende des Zentralrates seit 1945 bis heute waren und sind deutsche Juden, eine winzige Minorität ohne »Migrationshintergrund.« Dem Migrationshintergrund fast sämtlicher Juden und Jüdinnen in Deutschland dagegen fehlt die organische Verwurzelung der Juden vor 1933.
So ist der Zentralrat nicht zuletzt vermittels des »Beauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus« zwar eng integriert, aber mit flachen Wurzeln gesellschaftlich eingebunden. Noch im 19. Jahrhundert fanden sich Schtadlanim, jüdische Fürsprecher und Vermittler gegenüber der nichtjüdischen Umwelt. Ironischer Weise ist es heute umgekehrt: Nichtjuden sind heute Fürsprecher für Juden und bauen jüdische Museen. Juden sind gewissermaßen zu Schutzjuden mutiert. Dieser Versuch deutscherseits, einer engen erneuerten Bindung der Juden an deutsche gesellschaftliche und politische Strukturen ist wiederum ohne den Bruch von vor knapp hundert Jahren nicht denkbar.
Verwaltungsjudentum und Desintegration
Hier müssen wir nun Merkels Sicherheitsgarantie für Israels Existenz noch einmal genauer prüfen. Selbstverständlich gilt diese Erklärung implizit auch für die Juden in Deutschland. Absurd wäre es, wenn Angela Merkel den Israelis Sicherheit garantierte, nicht aber den jüdischen Menschen in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Merkel beschwört hier die Einheit von Juden und Deutschen, somit ein Versuch, den jüdisch-deutschen Bruch von 1933 zu überwinden. Jüdisches, ob in Israel oder Deutschland, wird geschützt, auch über den Bau jüdischer Museen, die nur in Deutschland staatlich finanziert und letztlich beaufsichtigt werden. Diese Einheit beschreibt Einvernehmlichkeit, gemeinsame Werte und Ziele und wurde zuletzt konkretisiert mittels der Einrichtung der Stelle des Beauftragten für jüdisches Leben.
Max Czollek hat unlängst den Begriff der Leitkultur wieder ins Spiel gebracht und gefordert, Juden sollten sich innerhalb der deutschen Gesellschaft »desintegrieren.« Tatsächlich sind Juden und Jüdinnen heute mehrheitlich fest in die deutsche Gesellschaft integriert: ihre Romane, Aufsätze, ihre Kunst und ihre öffentliche Präsenz werden hoch bewertet, und es gibt sogar einzelne jüdische Autoren, deren antideutsche Schmähungen von ihrer nicht-jüdischen Leserschaft begierig aufgesogen werden.

Der Islam in Deutschland
Im Gegensatz hierzu die Muslime in Deutschland. Während Juden insgesamt das »Gute« in der deutschen Gesellschaft repräsentieren, repräsentieren Muslime das Abstossende, das Fremde. Es geht soweit, dass Muslime oft pauschal als Antisemiten verunglimpft werden, der anti-Antisemitismus absurderweise ein Vehikel der Exklusion der Muslime geworden ist. Diese Form ideologischer Arbeit ermöglicht es der sozialliberalen Mitte der Gesellschaft heute, Juden gerade auch in die sogenannte Leitkultur mit einzubringen. Tatsächlich stellen Juden heute einen Teil der Leitkultur dar, immer mit Israel als Hintergrund, und Muslime, alleine schon aus religösen Gründen, das Fremde. Ein treffendes Beispiel hierfür ist eine Erklärung des Aussenministers Maas vor dem Bundestag zur Islamfeindlichkeit, zitiert aus Max Czolleks »Gegenwartsbewältigung«: »(d)ass im Bereich Rassismus und Diskriminierung (…) auch die Diskriminierung von Religionsgemeinschaften zugenommen hat. Auch antisemitische Straftaten und Diskriminierung haben zugenommen. Wir haben etwa im letzten Jahr entschieden, dass es einen Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung gibt.«
Czollek bemerkt im Weiteren, dass eine Frage zur Islamfeindlichkeit im wesentlichen in Richtung Schutz der Juden umgebogen wird. Dass Maas die Bekämpfung des Antisemitismus in Form einer verwalterischen Institution der Regierung sieht, die überdies eng mit dem Zentralrat der Juden verbunden ist, weist wiederum darauf hin, dass der Zentralrat als wichtigste jüdische Institution politisch eng angebunden ist. Der jüdisch-deutsche Bruch hat sich so auf seine Art im wesentlichen erledigt, Mit der neuen muslimischen Migration ist Deutschland neu gespalten.
Während in den letzten Jahren sich die Erinnerung an den Holocaust zunehmend routiniert und abzuschwächen scheint, verstärkt sich wiederum das kollektive Gedächtnis seit Ende der 70er Jahre an die Zeit vor der Schoah. Darauf ist andererseits jedoch auch die große Wirkung der vierteiligen »Holocaust«-Fernsehserie von 1979 zurückzuführen, denn »Holocaust« weckte das kollektive Gedächtnis an eine vergangene deutsche Identität, an einen früheren Charakter der deutschen Nation, in der das Judentum eine Grundkomponente darstellte: Die Serie zeigte in ihren dramatischen Punkten Juden und Deutsche in denselben Institutionen verknüpft, durch Heirat und Verwandtschaften verbunden. Eben diese Beschwörung persönlicher Verbindungen ist ein wiederkehrendes Motiv; etwa in »Der Skandal«. Das Verlangen, an diese verlorene Identität wiederanzuknüpfen, ist auch hinter den geradezu verzweifelten, vor allem literarischen, Versuchen zu sehen, die deutsche Geschichte des Bruchs um 1933 als persönlich erfahrene, jüdisch-deutsche Familienkatastrophe auf der Bühne des Gedächtnistheaters darzustellen.
Mit der Wende und der Neudefinition der nationalen Identität steigert sich überdies der durch den Bruch verursachte Phantomschmerz. Dies erklärt auch das tiefe, doch illusorische Bedürfnis, den Bruch zu überwinden: »Die evangelische Kirchengemeinde O. veranstaltet zusammen mit der Musikschule und der Klasse 6d des … Gymnasiums einen Gedenkabend zur Reichspogromnacht. Musikalisch gestaltet wird der Abend von dem Chor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Schalom Aleichem (…) Zu Gast sein wird der Zeitzeuge Henry Gruen, Schüler des Jüdischen Gymnasiums Köln bis 1938.«
Weitere Beispiele sind bekannt: Rekonstruktionen von ehedem als Scheunen oder Autowerkstätten missbrauchter Synagogen, Judaistikzentren und Museen ohne wesentlichen jüdischen Input, Klezmermusik als separates musikalisches Genre, Israel-Reisen und Stolpersteine. Gerade die Stolpersteine holen ja die jüdischen Namen fiktiv zurück in die Gemeinschaft.
Wie steht es aber nun mit der weitaus grösseren Minderheit, den Muslim*Innen? Zunächst einmal kamen Muslime vorwiegend als Kurden, Türken oder Araber ins Land. Doch der ethnische Diskurs passt nicht in die Vorstellung der deutschen Gesellschaft. Denn wie Juden religiös definiert werden, so eben auch Muslime. Und Muslime wiederum passen schlecht in die Konzeption der deutschen Gesellschaft vor dem Bruch. Der jüdische mainstream lebt in Deutschland unter Vorbehalt: wenn es in Deutschland wieder einmal »losgehen« sollte, dann ist Israel die Versicherung. Als Gegenleistung wird israelische Politik gegenüber den Palästinensern toleriert oder ignoriert.
Mit der Schaffung der neuen nationalen Identität erklärt sich auch die veränderte Stereotypisierung. Verkörperten die Juden der Weimarer Republik Geld, »Bolschewismus« und Modernität schlechthin, so gelten sie jetzt schon längst, und vor allem nach Elision ihrer unvornehmen östlichen Komponente, als noble, religiös und museal fundierte, Geschwister Oppermann, als Mendelssohns und Oppenheims und anderen jüdischen Menschen aus dem kultivierten Bürgertum, schlimmstenfalls als Einsteins oder als bösartige intellektuelle Randfiguren. In dieser Vorstellung aber sind durch den jüdisch-deutschen Bruch die real-existierenden Juden entmachtet; man lebte im Westen mit Gewissensbissen erst in der gemütlichen Republik von Bonn, heute dagegen in der Berliner Republik »weil man hier leben will« . Die Frage ist, »Warum?« Auch für die sozialliberale Mitte im heutigen Deutschland bleiben die Juden trotz allem ein Stück unergründbarer, tabuisierter Geschichte, und unergründbar sind Juden in diesem Deutschland sich auch selbst.
Im Auftrag des Evangelischen Landeskirchenamtes Bayern und des Katholischen Schulkommissariates Bayern



