Liebe Leserinnen und Leser,
vor 50 Jahren läuteten die »68er« das Ende der verknöcherten, biederen Welt Nachkriegsdeutschlands ein, das sich schwer tat, sein autoritäre Grundrauschen abzustellen.
Obgleich die Kirchen damals als Repräsentanten dieses alten Deutschlands galten, entsprechend in Frage gestellt und bekämpft wurden, trug die »frohe Botschaft« den emanzipatorische Charakter immer schon in sich.
So bewegte sich auch etwas in den christlichen Kirchen - etwa zeitgleich mit den Aufbrüchen der 68er, aber doch in großer inhaltlicher Distanz, viel vorsichtiger, vielleicht auch mutloser, meist zwei Schritte vorwärts und dann gleich wieder einen zurück - oft auch umgekehrt!
In dieser Zeit wurde Begegnung und Gespräch aus der Taufe gehoben: Bahnbrechend als ökumensiches Projekt der Evagelischen Landeskirche in Bayern und dem katholischen Schulkommissariat der Bayerischen Bischofskonferenz um den aufkommenden ökumenischen Geist im Bildungsbereich zu unterstützen und zu begleiten.
Ca. 40.000 Zeichen auf 8 Seiten bildeten genug Raum für aktuelle Themen aus der Erziehungs- und Bildungsarbeit, z.T. wissenschaftlich aufgearbeitet, gelegentlich auch mit zwei Beiträgen - evangelisch und katholisch - zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt.
25 Jahre später war die geschwisterliche Zusammenarbeit der Kirchen und besonders auch der Redaktion viel selbstverständlicher geworden.
Ein Beitrag pro Ausgabe reichte, und um den sich rapide verändernden Lesegewohnheiten gerecht zu werden, wurde die Textmenge auf ca. 17.000 Zeichen mehr als halbiert - zugunsten eines ansprechenden Layouts und großzügigerer Bebilderung.
Mittlerweile hatte die Auflage über 70.000 Drucke pro Ausgabe erreicht.
Jetzt - weitere 25 Jahre später - setzt uns nicht nur der Kostendruck zu: wir erhalten zwar weiterhin überwiegend sehr positive Rückmeldungen zu den einzelnen Heften, aber fast immer von älteren Kolleginnen und Kollegen.
Die Lehrergeneration »U40« hat wiederum veränderte Wege der Informationsbeschaffung und vermutlich auch der Informationsverwertung.
Internet, Google, Wikipedia, social Media u.v.m. machten auch vor den Bildungsarbeitern nicht halt.
So braucht auch die »Begegnung und Gespräch« nach weiteren 25 Jahren wieder eine Neuorientierung, die weit über das Gestalterische hinausgeht:
Wir werden nun in Papierform nur noch vierseitig erscheinen. Das halbiert zwar die Druckkosten, aber bietet nicht mehr den Platz, ein Thema tief genug und trotzdem ansprechend gestaltet zu präsentieren. Der zweite Teil unserer Zeitung wandert ins Netz. Dort ist dann Raum, ein Thema ohne Platzbeschränkung weiterzuentwickeln - nicht nur mit dem traditionellen Artikel sondern auch im Dialog mit unseren Lesern über Kommentare und Diskussionsforen, mit zusätzlichen Inhalten, Links, Bildern etc.
So könnten gerade diese neuen Möglichkeiten den Zeitschriftentitel mit neuem Leben füllen und »Begegnung und Gespräch« in eine neue Epoche führen.
Ob dieses Expriment gelingt und die »Begegnung und Gespräch« tatsächlich auch in der vernetzten Gesellschaft zu den spannenden Diskussionen zu Erziehung und Wissenschaft beitragen wird, hängt davon ab, ob wir es schaffen, das Konzept so mit Leben zu füllen, dass Sie als Leser gerne dieses Angebot nutzen und weiterempfehlen.
Viel Freude beim Lesen und beim Entdecken der neuen Möglichkeiten wünscht Ihnen
Ihre Redaktion
Achtundsechzig
Antiautoritärer Aufbruch und utopische Überforderung
Johano Strasser
Wir alle kennen die Bilder: Teach-ins und Redeschlachten in überfüllten Hörsälen, Demonstrationen, Sitz-Blockaden vor Druckereien des Springer-Konzerns, Institutsbesetzungen, Langhaarige in Jeans und Parka, in der einen Hand die Milchtüte, in der anderen das Megaphon, davor die Phalanx der Polizisten und an den Fenstern rundum Männer und Frauen, die verdutzt und indigniert dem Treiben der jungen Rebellen zusehen. Wie lange ist das her? Fünfzig Jahre. Und wenn es sechzig Jahre her ist, werden wir uns vermutlich wieder daran erinnern, wie wir uns bei Gelegenheit anderer runder Zahlen des Kriegsendes erinnern oder seines Ausbruchs, des Baus der Berliner Mauer oder ihrer Öffnung, der Mondlandung oder des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Die Studentenbewegung gehört mittlerweile zum Kostümfundus der Republik zusammen mit all den anderen Kuriositäten, die wir dann und wann hervorholen, um den Zeitablauf zu bebildern.
Aber die Geschichte ist kein Bilderbuch. Das Vergangene lebt fort, auch dann, wenn es verdrängt, verleugnet, ins Museum verbannt wird wie das andere Achtundsechzig, das sich jenseits des Eisernen Vorhangs ereignete und damals die revolutionäre Jugend im Westen viel zu wenig interessierte: der Prager Frühling und seine brutale Unterdrückung durch die Armeen des Warschauer Pakts. Wenn in der Bundesrepublik heute von Achtundsechzig die Rede ist, dann im Grunde immer nur vom Studentenprotest in der Bonner Republik. Die Geschehnisse jenseits der Systemgrenze und der nicht nur untergründige Zusammenhang mit denen im Westen kommen nur selten in den Blick. Dabei haben die Reformen, die die Politiker und Intellektuellen um Alexander Dubcek, Ludvik Vaculik, Eduard Goldstücker, Vaclav Havel und Ota Sik in der damaligen CSSR in Angriff nahmen, auch nach der Niederlage der Reformbewegung weitergewirkt bis zu Solidarnosc und dem annus mirabilis 1989, das in der Folge Europa und die Welt grundlegend veränderte.

Die große Mehrheit der Achtundsechziger hat sich – manche von Anfang an, andere erst nach einigen Umwegen - durchaus der Aufgabe gestellt, in einer komplizierten und widersprüchlichen Welt strukturelle Veränderungen voranzubringen, die – um Adorno gegen Adorno zu zitieren – möglichst allen Menschen ermöglichen sollten, ein „richtiges Leben im falschen“ zu führen. Es ging ihnen keineswegs nur um Identität und egozentrierte Selbstverwirklichung, sondern zumeist durchaus darum, die Realbedingungen der Gesellschaft in der Schule, in der Universität, in der Arbeitswelt schrittweise zu verbessern, damit in ihnen aufrechter Gang möglich werde. Sie machten Vorschläge zu einer Reform der Universität, gründeten Verlage und Zeitschriften für kritische Wissenschaft und avangardistische Kunst und Literatur, starteten Experimente genossenschaftlichen Wohnens und Arbeitens, gründeten Kinderläden und freie Schulen, die als Keime einer künftigen besseren Gesellschaft wirken sollten.
Was von unseren, den westlichen Achtundsechzigern und ihrer Zeit es verdient, im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt zu werden, wie der Aufbruch der rebellischen Jugend interpretiert, welche Lehren daraus gezogen werden sollen, das ist zwischen den politischen Parteien und Lagern umstritten, ist längst auch Gegenstand konkurrierender Geschichtspolitiken geworden. Die einen basteln immer noch unverdrossen oder wehmütig an ihrem revolutionären Heldenepos und an ihren legitimatorischen Legenden, die anderen an der kollektiven Dämonisierung der Achtundsechziger. Und dann und wann bemühen sich Historiker und Zeitzeugen um ein halbwegs adäquates Bild der Zeit, das dann unweigerlich Licht und Schatten enthält, in jedem Fall bunter ausfällt als die Schwarzweißbilder der Film- und Fernsehaufnahmen jener Zeit.
In konservativen Kreisen der Bundesrepublik war es lange üblich, die fünfziger und frühen sechziger Jahre als Zeitalter gesicherter Freiheit, des Bürgerfleißes und des verdienten Wohlstands für alle zu idyllisieren und im Studentenprotest nichts als das Zerstörungswerk gelangweilter Wohlstandskinder oder kommunistischer Unterwanderer zu erblicken. Zuweilen werden die Achtundsechziger auch heute noch für den stereotyp beklagten Werteverfall verantwortlich gemacht, als hätte es – von Ronald Inglehart bis Wolfgang Zapf – all die akribischen Untersuchungen über den Wertewandel und seine komplexen Ursachen gar nicht gegeben.
Zuweilen wird von ehemaligen Protagonisten der Bewegung der Eindruck erweckt, ein richtiger Achtundsechziger sei seinerzeit entweder Maoist oder Trotzkist oder Anarchist gewesen, habe Steine auf Polizisten geworfen, mit der RAF, der Bewegung 2. Juni oder den Roten Zellen sympathisiert und bestenfalls in den späten siebziger oder Anfang der achtziger Jahre gemerkt, dass er auf dem falschen Dampfer ist, habe sich dann flugs in einen braven Verfechter der parlamentarischen Demokratie verwandelt und damit das Recht erworben, jungen Leuten, die sich heute politisch engagieren wollen, schulterklopfend gute Ratschläge zu erteilen. Natürlich hat eine solche Selbstdarstellung auch die Funktion, eigene Fehler in milderem Licht erscheinen zu lassen: Wenn damals angeblich alle oder so gut wie alle mit Steinen warfen, mit Terroristen sympathisierten und kommunistische Diktatoren zu ihren Helden erkoren, dann war sozusagen die Zeit daran schuld und nicht man selber.

Ich halte von legitimatorischen Legenden der einen oder anderen Sorte wenig. Ich erinnere mich nur zu gut daran, welche Engherzigkeit und Bigotterie in der Adenauerzeit herrschte, dass es mit der Freiheit im Alltag der Bonner Demokratie nicht weit her war, dass überall selbsternannte Gouvernanten und Blockwarte junge Leute meinten gängeln zu müssen, dass Duckmäuserei vor Autoritäten üblich und der für die Demokratie konstitutive kritische Geist in der Schule, in der Universität, in den Medien, in der Arbeitswelt eine Seltenheit war. Als in den 60er Jahren sich allmählich eine widerständige Haltung in Deutschland ausbreitete, hatte ich, der ich aus Holland kam und von dort eine relativ lebendige Zivilgesellschaft kannte, den Eindruck: Die Deutschen werden langsam normal.
Die unerträgliche Heuchelei, mit der die entsetzlichen Grausamkeiten des Vietnamkriegs von den Politikern aller Parteien in Deutschland gerechtfertigt wurde, empörte auch mich. Ebenso die Tatsache, dass damals überall in Deutschland und in Österreich Naziverbrecher unter ihrem Klarnamen lebten und von einer nach wie vor ideologisch verseuchten Justiz nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Aber weder dies noch die oft völlig unangemessene und nicht selten gewaltsame Reaktion des Staates als Reaktion auf die Kritik der Jugend kann als Rechtfertigung dafür dienen, dass bald in Teilen der Studentenbewegung eine dogmatische Verengung und sektiererische Intoleranz zutage trat. Als in den 70er Jahren eine kleine Gruppe um Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhoff die RAF gründete und Anschläge verübte, fand das denn auch keineswegs, wie zuweilen behauptet wird, die klammheimliche Zustimmung der großen Masse der aufrührerischen Jugend. Vielmehr distanzierten sich die meisten eindeutig von diesem Irrweg der Gewalt.

Es kann also keine Rede davon sein, dass die Achtundsechziger insgesamt, naiv und unerfahren wie sie tatsächlich zumeist waren, mehr oder weniger zwangsläufig zur Beute dogmatischer Heilslehren und eines simplen Freund-Feind-Denkens wurden. Die große Mehrheit von ihnen - auch ein erheblicher Teil des SDS, erst recht die Jungsozialisten, die Gewerkschaftsjugend, die Falken, die vielen jungen Leute in den liberalen und christlich geprägten Studentenorganisationen - sprach sich von Anfang an dezidiert gegen Gewalt als Mittel der Politik aus und begab sich auf einen Weg der Reformen. Für mich und Tausende anderer führte dieser Weg in die SPD. Mit dem Anspruch, die Partei programmatisch und in ihrer Praxis am demokratischen Sozialismus auszurichten, mit radikaldemokratischen Vorstellungen von innerparteilicher Demokratie, mit unbändiger Lust an kontroversen Diskussionen, aber zugleich in der Überzeugung, dass konkrete Veränderungen wichtiger sind als revolutionäre Posen und Rechthaberei.

Die große Mehrheit der Achtundsechziger hat sich – manche von Anfang an, andere erst nach einigen Umwegen - durchaus der Aufgabe gestellt, in einer komplizierten und widersprüchlichen Welt strukturelle Veränderungen voranzubringen, die – um Adorno gegen Adorno zu zitieren – möglichst allen Menschen ermöglichen sollten, ein „richtiges Leben im falschen“ zu führen. Es ging ihnen keineswegs nur um Identität und egozentrierte Selbstverwirklichung, sondern zumeist durchaus darum, die Realbedingungen der Gesellschaft in der Schule, in der Universität, in der Arbeitswelt schrittweise zu verbessern, damit in ihnen aufrechter Gang möglich werde. Sie machten Vorschläge zu einer Reform der Universität, gründeten Verlage und Zeitschriften für kritische Wissenschaft und avangardistische Kunst und Literatur, starteten Experimente genossenschaftlichen Wohnens und Arbeitens, gründeten Kinderläden und freie Schulen, die als Keime einer künftigen besseren Gesellschaft wirken sollten.
Ich selbst habe Anfang der siebziger Jahre in Berlin an der Gründung des Netzwerks Selbsthilfe mitgewirkt, in dem zahlreiche solcher Projekte, u.a. die TAZ, eine Schule für Erwachsenenbildung und viele andere soziale und ökonomische Projekte eine erste Anschubförderung erhielten. Sicher waren die Hoffnungen, die mit diesen Vorhaben verbunden waren, zuweilen unrealistisch, auch kam es vor, dass sich Aktivisten quasi für die Lösung aller Weltprobleme zuständig fühlten, sich dabei heillos überforderten und als Sozialfälle endeten, wenn sie nicht rechtzeitig die Notbremse zogen. Wir waren, hätte Ernst Bloch gesagt, „ins Gelingen verliebt“, was uns einerseits Kraft und Mut zur Veränderung einflößte, uns aber manchmal auch auf gefährliche Weise blind machen konnte für unsere eigenen Grenzen.
Ich denke, dass der antiautoritäre Impuls der Achtundsechziger Bewegung wesentlich dazu beigetragen hat, aus Deutschland eine normale westliche Demokratie zu machen. Zwar hatte die aufmüpfige Jugend von 1968 von Anfang an sicher weiterreichende Ziele. Sie war in ihrer großen Mehrheit nicht nur antiautoritär und radikal demokratisch, sondern auch, wenn auch zumeist in einer verschwommenen Weise, antikapitalistisch. Was sie anleitete, war die vage Utopie einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, einer Gesellschaft ohne Krieg und ohne Ausbeutung, möglichst auch ohne repressive staatliche Strukturen, in der klassischen Formulierung des Kommunistischen Manifests „eine Assoziation, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist“. Aber als Willy Brandt die erste sozial-liberale Koalition unter das Motto setzte Wir wollen mehr Demokratie wagen, zeigte sich, dass ein Großteil, wenn nicht die Mehrheit der Achtundsechziger durchaus bereit war, sich auf den mühevollen Weg der Reformen zu begeben, und tauchten alsbald als Aktivisten in der Ökologie-, der Antiatom-, der Friedens-, der Alternativ- und der Frauenbewegung oder auf dem linken Flügel der SPD und bei den Grünen wieder auf, statt sich beleidigt zurückzuziehen, weil der Weltgeist nicht alles gehalten hatte, was er zu versprechen schien.
Dass Menschen heute auf die Straße gehen, um ihrem Protest sichtbaren Ausdruck zu geben, dass Macht in Staat und Gesellschaft sich rechtfertigen muss, dass Bürger sich in Initiativen zusammenschließen und sich behördlichen Anordnungen, die sie für falsch und ungerecht halten, widersetzen, dass sich so viele junge und ältere Menschen heute in Flüchtlingsinitiativen und anderen sozialen Projekten engagieren, dass so viele sich in NGOs für die Interessen der Menschen in der vormals so genannten „Dritten Welt“ einsetzen - dies alles wurde in Deutschland erst in der Folge der Studentenbewegung allmählich Bestandteil unserer politischen Kultur.
Aus dem Abstand von nunmehr sechzig Jahren kann man heute gelassener beurteilen, was an dem Aufbruch der Studenten richtig und fruchtbar war und was in gefährliche Sackgassen führte. Wohlfeile Rezepte für die heutige Jugend lassen sich daraus allerdings nicht destillieren. Jede neue Generation wird ihren eigenen Weg gehen, sich ihre eigenen Vorbilder suchen müssen: statt Ché Guevara und Ho Chi Minh, statt (wie in meinem Fall) Mahatma Gandhi und Martin Luther King heute vielleicht Malala und Emma Gonzales. Gerade heute, angesichts der sozialen und kulturellen Verheerungen, die der entfesselte Kapitalismus überall auf der Welt anrichtet, angesichts der manifesten Bedrohung der Demokratie auch im ach so zivilisierten Europa und angesichts der näher rückenden Gefahr eines neuerlichen großen Krieges scheint mir, dass da im Sinne Ernst Blochs noch etwas „unabgegolten“ ist, das nach Fortsetzung verlangt und nach Übersetzung in die Sprache und die Bilder unserer Zeit. Insofern macht es heute auch praktisch Sinn, des Aufstands der unruhigen Jugend von 1968 zu gedenken, deren Kinder und Enkel, auch wenn sie dies manchmal zu vergessen scheinen, sich ihre Welt erst noch werden erkämpfen müssen.
Zum Autor:
Johano Strasser, geb. 1939.
Übersetzer, Politologe, Journalist und Schriftsteller.
Seit 1975 Mitglied der Grundwertekommission der SPD.
Von 2003 bis 2013 Präsident des
P.E.N.-Zentrums Deutschland.
Bilderserie: »68«
bearbeitete Screenshots von Fernsehdokumentationen
Christoph Ranzinger
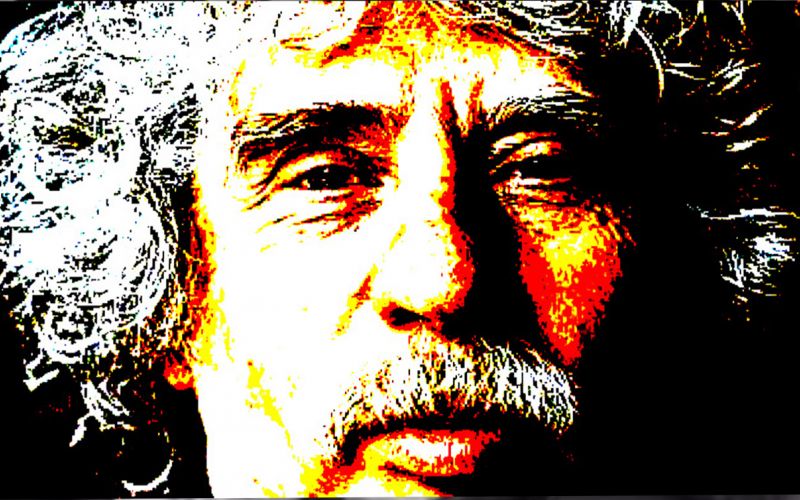
Heribert Prantl:
1967 gab in einer Repräsentativumfrage fast die Hälfte der befragten Deutschen an, dass der Nationalsozialismus eine im Prinzip gute Idee gewesen sei. Dann aber kam 1968, das Ende des Beschweigens der NS-Vergangenheit, es kam die antiautoritäre Protestbewegung. Und was kommt jetzt? In den Feuilletons fragen sich Alt-Achtundsechziger, ob alles umsonst gewesen sei. Diese Weinerlichkeit passt so gar nicht zu den koketten Happenings der jungen Kommunarden von damals und zur fröhlichen Autoritätskritik von 1968.
Jürgen Habermas wurde 1988 gefragt, was von 1968 geblieben sei. Er hat die bisher beste Antwort gegeben: »Frau Süssmuth«, hat er gesagt. Er meinte die Fundamentalliberalisierung der Republik. Frauenemanzipation, Ökologie- und Anti-Atom-Bewegung, die Friedensbewegung, eine entspießerte Sexualmoral, die umfassende Demokratisierung der Gesellschaft – das alles ist Erbe von 1968, auch der klare, scharfe Blick auf den Nationalsozialismus. Gewiss: Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit haben vorher schon andere betrieben, der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer zum Beispiel. Und sexuelle Liberalisierung ging von Knef/Kolle/Uhse aus. Aber die Ungebärdigkeit der Achtundsechziger hat all dem Power gegeben. Der kulturelle Umbruch von 1968 war und ist der nachhaltigste Umbruch der Gesellschaft seit 1945. Die Kraft des Umbruchs zeigt sich darin, wie sich Rechtskonservative und AfD-ler daran abarbeiten.
In fast jedem Deutschen steckt ein Achtundsechziger, auch in denen, die nicht halb so alt sind. Bei den einen ist es so, dass sie, oft ohne es zu wissen, vom 68er-Erbe zehren; bei den anderen ist es so, dass sie enttäuschte Hoffnungen und ungelöste Lebensprobleme auf das Wirken der Achtundsechziger zurückführen. Kurz: Die Bundesrepublik ist ein verachtundsechzigter Staat.
aus: Heribert Prantl: Vom Grossen und Kleinen Widerstand – Gedanken zur Unzeit.
S 78 ff Süddeutsche Zeitung Edition 201 (mit freundlicher Genehmigung des Autors)
Gerhard Gruber:
Meine Erinnerungen an die 68er Jahre
In meiner Erinnerung an die 68er Jahre steht neben dem Bild von heftigen Konflikten in Staat und Gesellschaft, bei dem es sogar tödliche Attentate gab, das Bild der insgesamt positiven, friedlichen Reform der (kath.) Institution Kirche und des kirchlichen Lebens nach dem II. Vatikanischen Konzil. Als Konzilssekretär des Erzbischofs von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner, hatte ich das Konzil hautnah miterlebt.
Im Jahr 1968 berief mich der Kardinal zu seinem Generalvikar für das Erzbistum München und Freising. Mir fiel die Aufgabe zu, die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse im Erzbistum voranzutreiben: die Neugestaltung der Liturgie in der Muttersprache und mit Rückgriff auf den Reichtum der Hl. Schrift; die Förderung der teilweise neuen Seelsorgeberufe, Ständiger Diakon, Pastoralreferent/-referentin, Gemeindereferent/-referentin; die Einbeziehung der Laien und die Zusammenarbeit mit ihnen in den Katholikenräten wie auch der Priester in den Priesterräten; dann auch die Neuorientierung der Religionspädagogik hin auf kind- und jugendnahe Formen, was schon lange ein Anliegen des Deutschen Katechetenvereins unter Leitung von Domkapitular Dr. Hubert Fischer und engagierter Seelsorger, wie z.B. meinem Bruder, Pfarrer Elmar Gruber, war. All das sollte geschehen unter dem Leitbild der Kirche als „Volk Gottes“ und „Ursakrament“.
Das war eine wunderbare, geradezu historische Aufgabe. Ich denke an diese Zeit gerne und in Dankbarkeit zurück, dankbar für die vielen Anregungen, für die Mitarbeit und das Verständnis von Priestern und Laien im Erzbistum, und letztlich dankbar gegenüber dem Herrn der Kirche, Gott, dem Geber alles Guten.
Dr. Gerhard Gruber, ehem. Generalvikar der Erzdiözese München-Freising
Hellmut Behringer:
„Seit der Zeit der Studentenunruhen habe ich mich mit der Frage des Sozialismus im Christentum immer wieder beschäftigt, weil die sozialen Probleme der Menschen bleibende Themen der christlichen Kirchen sind. Seitdem verfolge ich die politische Entwicklung in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, lese viel über politische Verfolgungen, den KGB und die Christen im Osten. Das Leid mancher Menschen in den Ländern des Sowjetreiches berührt bis heute mein Herz.“
Hellmut Behringer, ev. Pfarrer i.R., Nürnberg








